Unbedingt lesen! Birk Meinhardt, Wie ich meine Zeitung verlor, Ein Jahrebuch, Verlag: Das Neue Berlin, 143 S., 15,-€
143 Seiten, die es in sich haben! Ein Erlebnisbericht aus den Hinterzimmern des deutschen Qualitätsjournalismus – und was von diesem geblieben ist. Zugleich ist das Buch die autobiografische Erzählung eines Vollblut-Reporters, der als junger Mann nach der Einheit von Ostberlin nach München zur Süddeutschen Zeitung wechselte. Hier, an Bord eines der Flaggschiffe des demokratischen Meinungsstreits, da war sich Meinhardt sicher, würde er das Gesetz, wonach er angetreten, nie wieder brechen müssen: „Zur Wende wusste ich, was ich niemals mehr wollte, nämlich mich noch einmal in einen solchen Zwiespalt begeben;…ich habe mit mir abgemacht, ungesunde und mich ewig beschäftigende Kompromisse nicht mehr einzugehen, soll heißen, sollte jetzt noch einmal ein Text aus politischen Gründen aus der Zeitung fliegen oder sollte jetzt ein Text aus politischen Gründen auch nur zurechtgebogen werden, würde ich in der Zeitung, in der sowas geschieht, sicher nicht mehr arbeiten, jedenfalls nicht mehr als Journalist.“
Dass es eines Tages wieder zu vergleichbaren Zumutungen kommen könnte wie in DDR-Zeiten, erschien Meinhardt damals nur als eine abstrakte Möglichkeit ohne Anschaulichkeit. Er handelte also in seiner Tätigkeit als Journalist entsprechend der Maxime, dass es für viel wichtiger gehalten werden muss, zu sehen, was ist, als festzustellen, was sein soll – und er hatte damit einige Zeit lang beachtlichen Erfolg. 1999 und 2001 erhielt er den in seiner Zunft begehrten Kisch-Preis.
Ein erstes Déjà-vu-Erlebnis, dass es selbst im journalistischen SZ-Paradies verbotene Früchte gibt, hatte Meinhardt, als ihm der Leserbriefredakteur sagte, der Außenpolitikchef habe darauf gedrungen, Nato-kritische Briefe zum Kosovo nicht oder nur ganz vereinzelt zu bringen. Meinhardt wollte es nicht fassen. Es war dann ein schmerzhafter, sich hinziehender Prozess der Desillusionierung: die mehrmals wiederholte Erfahrung, dass es selbst in der Süddeutschen mit der Freiheit des Wortes, wenn es darauf ankam, nicht allzu weit her war. In den Tagen der friedlichen Revolution war die Freiheit im Kultur- und Geistesleben das Schibboleth aller gegen den vormundschaftlichen Staat rebellierenden Kräfte gewesen. Jetzt, knapp zwei Jahrzehnte später, musste Meinhardt sich eingestehen, dass seine einstige Hoffnung, „ohne Beschränkungen, ob fremde oder selbst auferlegte, endlich tabulos Zeitung“ zu machen, immer mehr ins Wanken geriet. Denn auch die SZ scheute sich nicht, wenn es den Verantwortlichen opportun erschien, an der Fabrikation der staatlicherseits gewünschten >öffentlichen Meinung< mitzuwirken, selbst um den Preis, dadurch zum direkten Widersacher der Meinungsfreiheit zu werden.
Wie es dabei in concreto zugegangen ist, schildert Meinhardt anhand redaktioneller Debatten, wobei der Streit um vier nicht veröffentliche Reportagen, die im Buch abgedruckt sind, im Mittelpunkt steht. Auf zwei dieser journalistischen Glanzstücke sei hier ausdrücklich hingewiesen: Mit einer geradezu prophetischen Erzählung über die desaströsen Konsequenzen des in New York und London ansässigen Investmentbankings der Deutschen Bank, Jahre vor der Finanzkrise geschrieben, akribisch recherchiert, beginnt die Entfremdung zwischen der Redaktion und Meinhardt. So wie er das „Nicht-Funktionieren des ganzen Gewerbes“ und den „Verlust jeglicher Moral“ beschreibt, das ging als profunde Systemkritik entschieden zu weit.
2010 dann der nächste Eklat. Meinhardt berichtet über einen brandenburgischen Rechten, der, verurteilt zu acht Jahren wegen eines angeblich versuchten Mordes und versuchter Brandstiftung, vier Jahre und vier Monate unschuldig gesessen hat. Das stellte jedenfalls das Landgericht Frankfurt / Oder in einem Wiederaufnahmeverfahren fest. Und er recherchiert über den bundesweit zu Schlagzeilen führenden Fall des Ermya Mulugeta in Potsdam. Man erinnere sich: Es war dies der ganz banale Fall einer Schlägerei an einer Straßenbahnhaltestelle, den der Generalbundesanwalt Kai Nehm trotz anderslautender Ermittlungsergebnisse der örtlichen Polizei im vorauseilendem Gehorsam an sich gezogen hat, um durch die fernsehwirksame Vorführung (Hubschrauber, Augenklappen, Ohrschutz) der vermeintlich rassistisch handelnden deutschstämmigen, weißen Täter in Karlsruhe höchste Gefährlichkeit und schnelles Durchgreifen des Staates zu demonstrieren. Es lag ja der Bundeskanzlerin „daran, dass dieser Fall schnell aufgeklärt wird und dass wir deutlich machen, dass wir Fremdenfeindlichkeit, Gewalt, rechtsradikale Gewalt aufs Äußerste verurteilen.“
Dem ehemaligen Regierungssprecher Uwe-Karsten Heye, Vorsitzender des Vereins „Gesicht zeigen“, reichte der Wunsch Merkels, ein Exempel zu statuieren, nicht aus. Er legte Wert darauf, gleich das halbe Bundesland als rassistisch zu denunzieren. „Es gibt kleine und mittlere Städte in Brandenburg und anderswo, wo ich keinem raten würde, der eine andere Hautfarbe hat, hinzugehen. Er würde sie möglicherweise lebend nicht mehr verlassen“, gab Heye zu Protokoll. Brandenburg als Mördergrube. Daraus wurden dann die No-go-areas. Auch der Fall Ermyas Mulugeta endete mit Freispruch.
Was die Reportage Meinhardts, der mit fast allen Beteiligten im Justiz- und Polizeiapparat gesprochen hat, zu etwas Besonderem macht, ist, dass er den Fall nicht einfach unter der Rubrik „Justizirrtum“ abbucht. Justizirrtümer passieren. Mal ist die Beweislage undurchsichtig, Zeugen erinnern Ereignisse, die nie stattgefunden haben, Spuren werden fehlerhaft interpretiert usw. Wenn dazu aber noch „Beflissenheit, Beeinflussbarkeit, Zweifelsverdrängung“, kommen, wie Meinhardt schreibt, dann ist die Rechtsstaatlichkeit gefährdet. Nicht zu vergessen das unermüdliche Entrüstetsein im „Kampf gegen Rechts“, was zu ständiger Überbietung beim Anklagen und Beschuldigen anfeuert. Und, wie Nietzsche schon sagt: „Niemand lügt so sehr als der Entrüstete.“
Und was erlebt Meinhardt nun in der Redaktion der SZ? Die Rechten könnten seine Geschichte für ihre Zwecke nutzen, heißt es da auf einmal. Also dasselbe Argumentationsmuster, was er schon zur Genüge aus der DDR kannte. „Deine Kritik hier, hieß es, mag ja berechtigt sein, aber sie könnte dem Klassenfeind zupass kommen, also lassen wir das bleiben.“
Birk Meinhardt hat seine Zeitung verloren. Er hat gekündigt und sich der Schriftstellerei zugewandt (letzter Roman: Brüder und Schwestern, erschienen bei Hanser).
Rolf Henrich

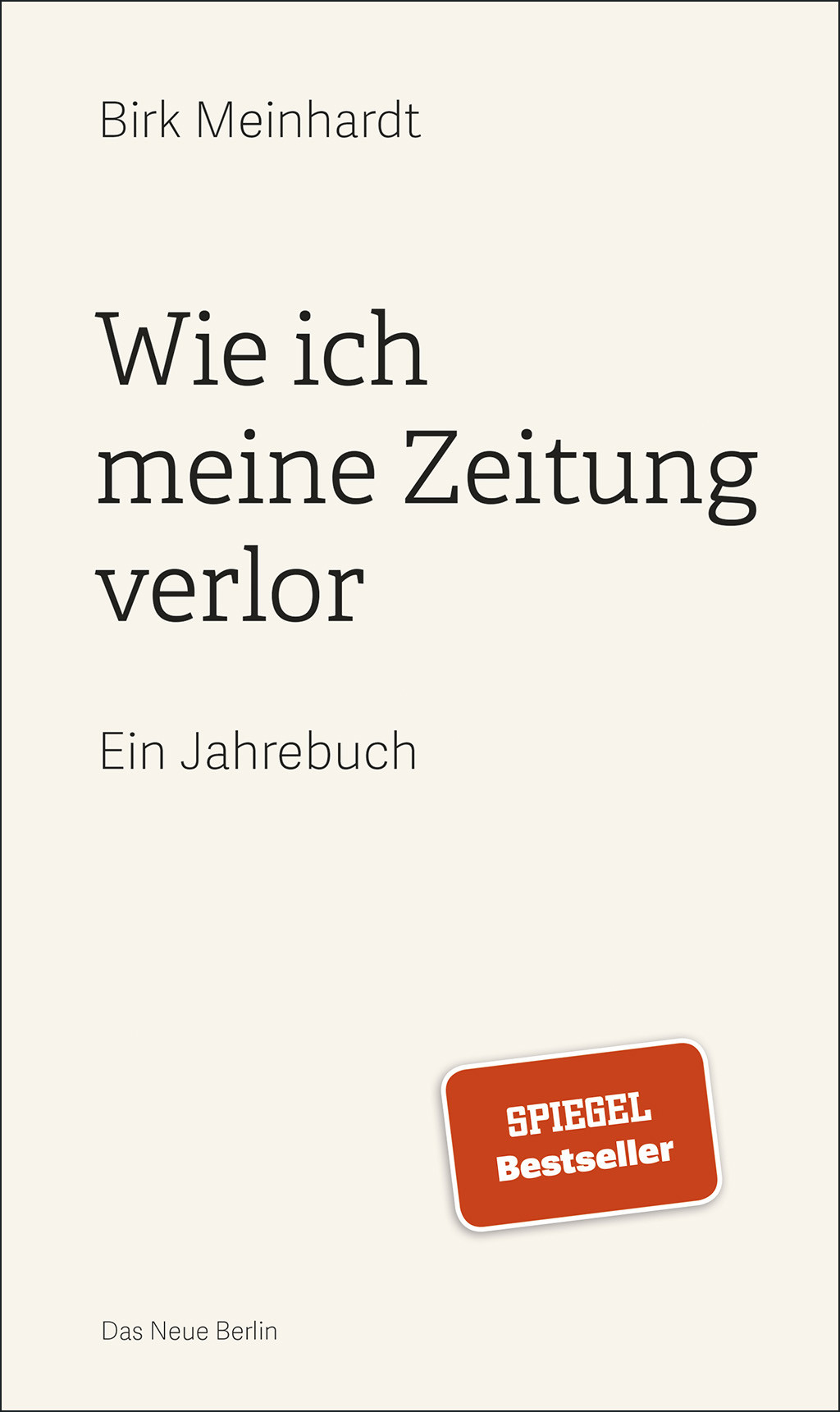
Dazu passt die Debatte um Bari Weiss:
https://www.bariweiss.com/resignation-letter
Liebe Grüße
K.
LikeLike
In der Tat hat die „New York Times“ einen Gastkommentar des äußerst konservativen Senators Tom Cotton „Send in the troops“ zugelassen. Wie in der FAZ heute zu lesen, hat die dafür verantwortliche Redakteurin Bari Weiss die NYT nunmehr verlassen – offenbar auch wegen Mobbing: Die Auffassung des Senators – notfalls Einsatz von Soldaten im Kampf gegen die Gewalt der Straße – darf nicht Gegenstand eines öffentlichen Diskurs sein. Schade.
R.Z.
LikeLike