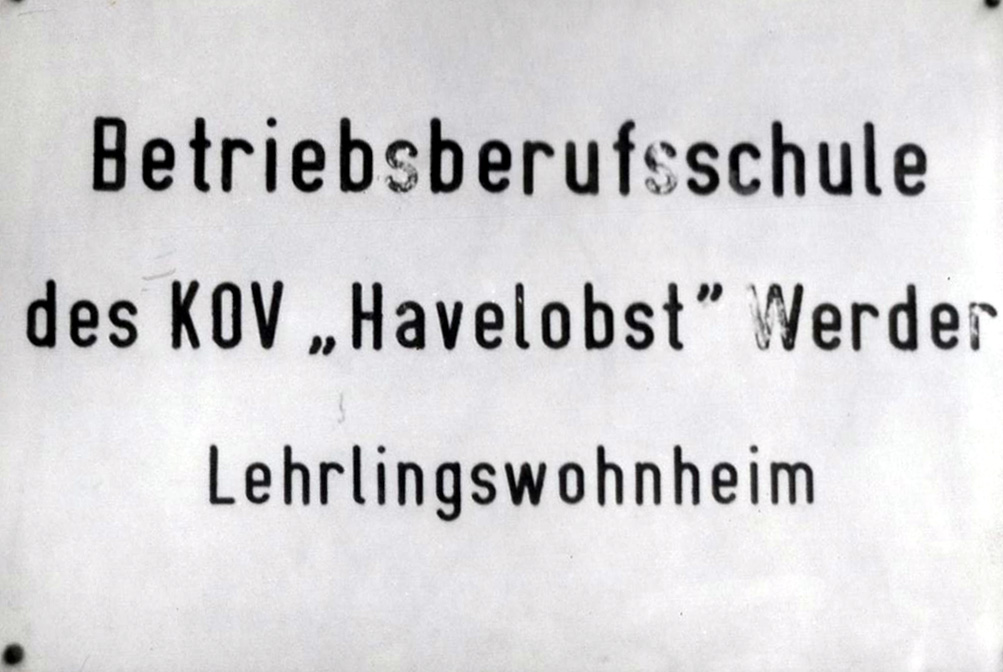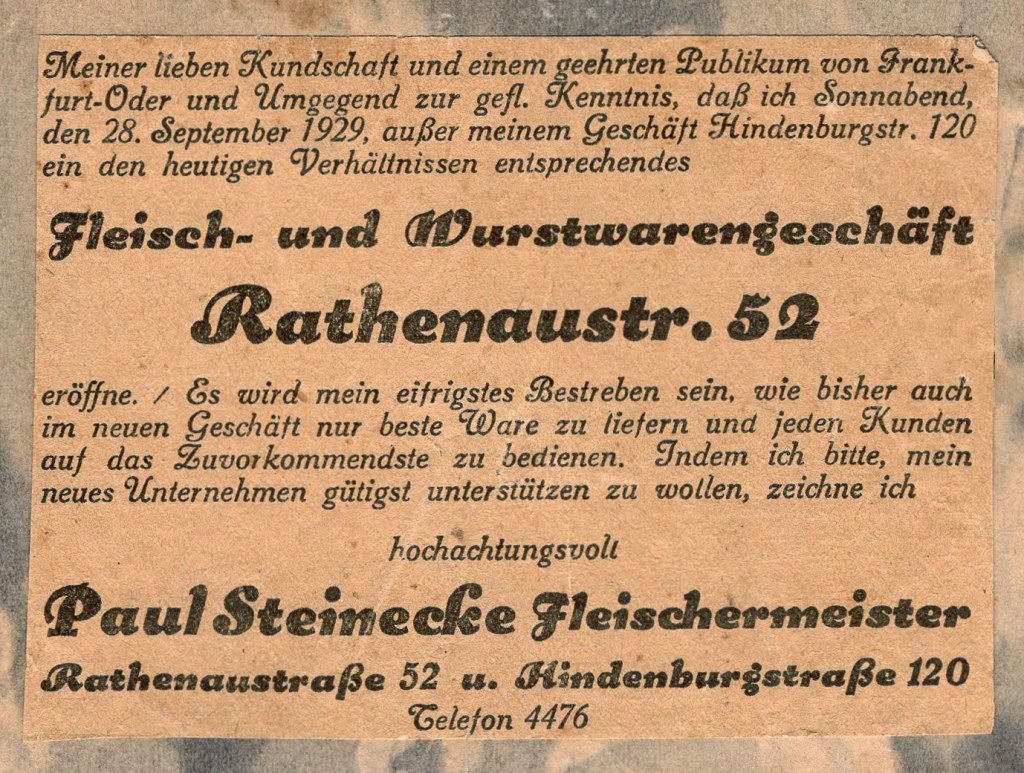Das weltpolitische Geschehen weckt Erinnerungen an eine Zeit, in der die Jugendlichen der DDR auf Krisen- und Katastrophenfälle vorbereitet wurden.
In der 9. und 10. Klasse gab es eine vormilitärische Ausbildung. Auf dem Stundenplan stand auch das Fach Zivilverteidigung (ZV). Die Jungen mussten zudem in ein Wehrlager. Die Mädchen machten eine Sanitätsausbildung, was von Vorteil war. Der Nachweis darüber galt für den Führerschein.
Auch später in der Berufsschule gab es die Unterrichtsstunden ZV. Unser Lehrer für Fotochemie hatte seinen Grundwehrdienst geleistet und war Gefreiter. An unserer Berufsschule Fritz-Perlitz in Potsdam war er für den ZV-Unterricht zuständig.

Ich erinnere mich an seine Ankündigung, in der nächsten Stunde werde der Umgang mit der Gasmaske geübt. Nicht für jeden stand eine zur Verfügung. Es sollten sich deshalb Zweiergruppen bilden. Der Gummigeruch und die Vorstellung, wie viele diese Maske schon getragen hatten, bereitete mir mehr als nur Unbehagen. Meine Schulfreundin und ich planten, diese Unterrichtsstunde für uns vorzeitig enden zu lassen. Durch Täuschung eine Befreiung vom Unterricht zu erhalten, fiel mir nicht leicht. Mir wurde deshalb schon übel, bevor ich die Gasmaske aufgesetzt hatte. Erschrocken und genauso ratlos wie Professor „Schnauz“ in der Feuerzangenbowle schlug unser Lehrer vor, ich solle an die frische Luft gehen. Am besten gleich um die Ecke in die Poliklinik und natürlich in Begleitung. So hatten meine Freundin Heike und ich uns das vorgestellt. Ein kurzer Abstecher zur Poliklinik für den Nachweis meiner Unpässlichkeit und einem freien Nachmittag ohne Gasmaske im schönen Potsdam stand nichts mehr im Wege.


Meine nächste Berührung „militärischer Art“ hatte ich kurz nach abgeschlossener Berufsausbildung. Ein Offizier der NVA kam mit einer außergewöhnlichen Bitte in unser Fotogeschäft in der Oderallee.
Im Kasernengebäude der NVA im Stadtteil Frankfurt-Westkreuz, wo Truppenteile der NVA stationiert waren – logistische Einheiten und rückwärtige Dienste -, war ein Fotolabor eingerichtet worden. Neueste Technik und niemand wusste damit umzugehen. Der Offizier war auf der Suche nach jemandem, der einige Soldaten unterrichten konnte, angefangen von Materialkunde, dem Ansatz der Bäder, über die Filmentwicklung zum fertigen Bild.
Auf die Frage unserer Chefin, wer von uns das machen würde, meldete sich niemand. „Na, Betti“, wandte sie sich an mich, „das wäre doch etwas für dich.“
Was, ausgerechnet ich?! Ich war erschrocken, freundete mich aber mit dem Gedanken an, überwand mich und sagte zu. Eine kleine Nebeneinnahme, natürlich ordentlich abgerechnet, warum nicht?!
So trat ich meinen Dienst bei der Nationalen Volksarmee als Ausbilderin an.
Donnerstags hatten wir einen verkürzten Arbeitstag, weil unser Laden geschlossen blieb. Also wurde ich jeden Donnerstag pünktlich um 15.00 Uhr abgeholt. Ein Jeep fuhr vor mit Offizier und Fahrer, der Offizier hielt mir, damals gerade noch 18 Jahre alt, die Tür auf und los ging’s zur Kaserne. Meine beiden Begleiter gehörten zu der kleinen Gruppe, der ich die Abläufe und Handgriffe in einem Fotolabor erklären sollte. Jedesmal wurde ich gefragt, ob noch weitere Materialien nötig wären. Geld spielte offenbar keine Rolle. Was ich anforderte, stand in der nächsten Woche parat. Von Engpässen keine Spur. Ein tolles Gefühl!
Am Ende jeden Kurses wurde ich nach Hause gefahren. Inzwischen machte mir das Unterrichten Spaß und ich genoss den Chauffierservice. Nach wenigen Monaten war aber die Tätigkeit bei der NVA leider beendet. Meine Schüler beherrschten die Arbeitsschritte von der Filmentwicklung zum fertigen Bild, einschließlich Trocknung und Kantenschnitt.
Es wurde ein wenig unruhig in den folgenden Monaten. Das starre Gebilde der DDR schien ins Wanken zu geraten. Man hatte das Gefühl, die Partei- und Staatsführung wollte retten, was zu retten ist.
Ein tägliches Ritual bei der Arbeit war unser gemeinsames Frühstück.
An einer langen Tafel (wir waren 16 Kollegen) fanden monatlich Arbeits- und Brandschutzbelehrungen statt, für die jeder unterschreiben musste. Aufträge wurden verteilt, Klatsch und Tratsch ausgetauscht und es gab Mitteilungen außer der Reihe, wie diese:
Der Direktor unseres Mutterbetriebes, des Dienstleistungskombinats (DLK) in der Hafenstraße, hatte mitgeteilt, dass ein neuer Kollege in unsere Fotoabteilung kommt, so unsere Chefin. Das Merkwürdige daran, ihn hatte niemand angefordert. Wir waren ausreichend besetzt und so dachten wir uns unseren Teil. Er war weder Laborant noch Fotograf, half mal hier und mal dort. Jeder achtete ihm gegenüber auf seine Worte. Das waren wir gewöhnt, aber nicht innerhalb unseres Betriebes. Nun also ein Fremdkörper in unserer eingeschworenen Gemeinschaft?

Er war freundlich und versuchte in Gesprächen vieles in Erfahrung zu bringen. Wir blieben höflich und distanziert. Sein Dasein in unserer Abteilung war nicht mehr von Bedeutung und erledigte sich am 9. November 1989. Wir sahen ihn nie wieder, obwohl nun jede zusätzliche Hand hilfreich gewesen wäre, um die nicht enden wollenden Schlangen vor unserem Laden zu bewältigen. Passbilder für Reisedokumente waren gefragt. Aber davon ein andermal.
Bettina Zarneckow
Unsere Preise von damals für handgemachte
schwarz/weiß Passbilder:
4 Stück: 2,25 Mark
6 Stück: 2,50 Mark
8 Stück: 2,80 Mark
10 Stück: 3,10 Mark