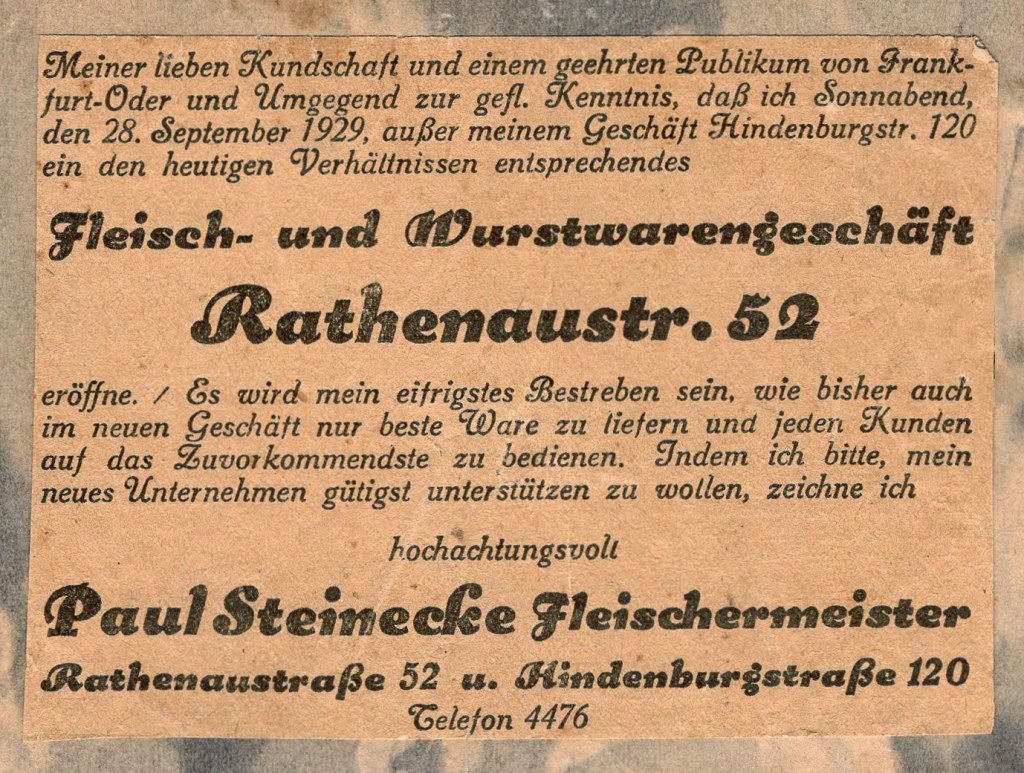Eine politische Rückschau? Nein, die möchte ich nicht halten. Auch die derzeitige Lage meines Vaterlandes möchte ich nicht betrachten, nachdem ich nun 35 Jahre Bundesbürger bin.
Nur einige Erinnerungen.
Kurz nach der Wende überschwemmten unbekannte Dinge den Osten. Auf dem Markt vor dem Frankfurter Rathaus rätselten meine Mutter und ich, was das wohl für eine exotische Kartoffelsorte sei, deren Schale so pelzig war. Die Verkäuferin klärte uns auf: Kiwis. Das Stück für eine Mark. (Das war noch vor der Währungsunion. Danach wurden unsere Ersparnisse quasi halbiert, der Stückpreis für Kiwis aber auch gesenkt.)
Nein, wir mussten nicht gleich alles probieren und gingen weiter.
Eine Arbeitskollegin war vor der Wende in den Westen ausgereist und hatte mir ihren Trabi verkauft. Mein erstes Auto. Ich hütete es wie meinen Augapfel und stattete es aus. Fell als Schonbezug, ein Kissen für die Rückbank, den Aschenbecher funktionierte ich zur Ablage um und schlug ihn mit Filz aus. Ein Bekannter meiner Mutter reparierte dies und das an meinem Auto und „motzte“ es ein wenig auf. Es machte ihm Spaß. Wo er die Ersatzteile herbekam, blieb sein Geheimnis. Wir trafen uns in seiner Garage, unterhielten uns gern und stundenlang über Autos, Fußball, Gott und die Welt. Ich saß auf seiner Werkbank, während er an meinem Auto schraubte. Ein Autoradio wollte er noch einbauen.
Das kaufte ich mir kurz nach dem Mauerfall im KaDeWe. Am Staunen über ALLES waren wir DDR Bürger sofort zu erkennen. Der Verkäufer schlug vor, ich solle das Blaupunkt Radio, das ich mir ausgesucht hatte, einige Straßen weiter in einem Geschäft kaufen, das das gleiche Radio wesentlich billiger anbieten würde. Das war für mich nicht zu verstehen. War ich doch Festpreise (EVP) gewöhnt. Wieso sollte es dieses Radio woanders preisgünstiger geben? Ich kaufte das Radio mit integriertem Kassettenteil und vier Lautsprecherboxen natürlich im KaDeWe und war glücklich über den Sound in meinem „Weggefährten“.
Das Wort Stau war meiner Mutter und mir kein Begriff. Wenige Monate nach der Wende kauften wir für meine Mutter einen roten Opel Kadett. Wir bestellten und holten ihn aus Bochum ab. Mein Cousin wohnte dort und arbeitete bei den Opelwerken. Der Wagen war natürlich mit einem Autoradio ausgestattet. Auf der Nachhausefahrt hörten wir mehrfach Staumeldungen. Hatte das für uns eine Bedeutung? Nein, wohl nicht. Erst, als der Verkehr zähflüssig wurde und wir schließlich zum Stehen kamen, begann es uns zu dämmern. Nicht nur dass die Fahrt ohnehin schon ein Abenteuer war, standen wir nun auch noch in unserem ersten „dicken“ Stau.

Nach der Wende konnte man sich kaufen, was das Herz begehrte. Man brauchte nur genügend Geld.
Damals in der DDR hatte man Geld, nur seine Wünsche konnte man damit regelmäßig nicht erfüllen. Es sei denn, man hatte Beziehungen oder startete ungewöhnliche Aktionen. Ein Bekannter wollte sein Bad neu fliesen.
Fliesen? Richtig, Mangelware. Er hatte gehört, dass am nächsten Tag beim VEB Baustoffversorgung Frankfurt (Oder) Fliesen an Privatpersonen abgegeben werden sollen. Ansich belieferte die Baustoffversorgung nur Betriebe. Das Prinzip, wer zuerst kommt, mahlt zuerst, war vielen DDR Bürgern in Fleisch und Blut übergegangen. Also bekam der Mann von seiner Frau Stullen geschmiert, eine Thermoskanne mit heißem Tee, einen Schlafsack, eine Decke und übernachtete vor der Baustoffversorgung. Nicht allein, wie er tags darauf erzählte. Diese Idee hatten auch andere. Seine Nacht war kurz, unterhaltsam und er bekam seine Fliesen.
Verschiedene Dienstleistungen dauerten in der DDR eine halbe Ewigkeit. Fast alles wurde damals zur Reparatur gebracht. Fernseher, Tonbandgeräte, Plattenspieler, Kassettenrekorder, Schuhe, Strumpfhosen, Staubsauger, Uhren. Meine Lieblingsarbeitskollegin, eine herzliche, gepflegte und attraktive Frau, brachte ihre Armbanduhr zum Uhrmacher nebenan und bat mit einem Augenaufschlag um schnellstmögliche Reparatur. Der klein geratene, in seiner ganz eigenen Uhrenwelt lebende Uhrmacher versprach, offenbar von ihr angetan, die Fertigstellung schon zum nächsten Tag. Am folgenden Tag holte sie ihre Uhr ab. Sie bekam sie heil und poliert vom Meister zurück und zückte erfreut ihr Portemonnaie.
Wenig später fand ich sie vollkommen geknickt an ihrem Schreibtisch. „Stell dir vor, Betti“, und sie erzählte mir: „Weil ich so eitel bin, du kennst mich ja, Betti, habe ich beim Suchen nach Trinkgeld für den Uhrmacher auf meine Brille verzichtet. Ich wusste, dass ich ein Fünfmarkstück habe, fand und gab es ihm. Eben schaue ich in mein Portemonnaie und sehe, dass ich ihm fünf Westmark gegeben habe. Die Geldstücke haben doch eine ähnliche Größe.“ Das ließ sich natürlich nicht mehr rückgängig machen. Was das für ein schmerzlicher Verlust war, kann man sich heute nicht mehr vorstellen! Wenn wir uns treffen, lachen wir darüber, aber einen kleinen Stich gibt es immer noch.

Wer etwas Besonderes wollte, kaufte im Chic-Laden. Auch hier galt: wer zuerst kommt…
Ich brauchte Übergangsschuhe und versuchte mein Glück. Wunderbar, ein paar weiße Stiefel im Westernstyle. Ich fand sie todschick. Es gab sie aber nur in Größe 40 und mit einem kleinen Produktionsfehler. Egal! Meine Größe 39 wurde nicht geliefert, also nehme ich sie eine Nummer größer und trage sie mit einem paar dickeren Socken. Der Fehler, ein kleiner Riss auf dem Spann, weshalb sie wahrscheinlich nicht „nach drüben“ gegangen sind, ist zu vernachlässigen. Ab zur Kasse und 400 Mark auf den Tisch gelegt, das mehrfache meines Lehrlingsgehalts.
Wie viele Jahre ich die Stiefel getragen habe, das weiß ich nicht mehr. Die Absätze jedenfalls ließ ich mir mehrmals besohlen. Jetzt gibt es sie nur noch in meiner Erinnerung und auf Fotografien. Vieles ist eben längst Geschichte.

Bettina Zarneckow
„Trabant“ stammt aus dem Slawischen und bedeutet Begleiter oder Weggefährte.